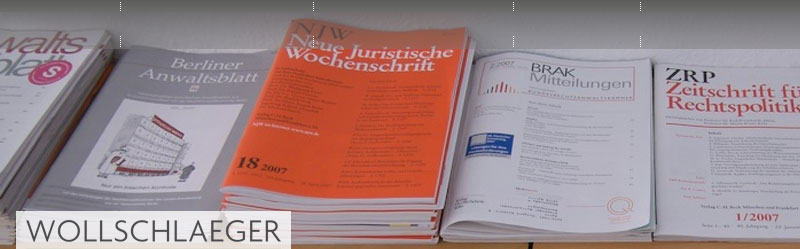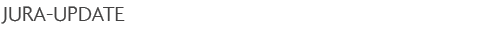Geschlechtsspezifische Benachteiligung wegen Schwangerschaft bei einer Stellenbesetzung
28. Januar 2011Bewirbt sich eine schwangere Arbeitnehmerin um eine Stelle und besetzt der Arbeitgeber, dem die Schwangerschaft bekannt ist, diese Stelle mit einem Mann, so hat die Arbeitnehmerin eine geschlechtsspezifische Benachteiligung dann glaubhaft gemacht, wenn sie außer der Schwangerschaft weitere Tatsachen vorträgt, welche eine Benachteiligung wegen ihres Geschlechts vermuten lassen. An diesen weiteren Tatsachenvortrag sind keine strengen Anforderungen zu stellen.
Die Klägerin war bei der Beklagten im Bereich „International Marketing“, dem der „Vicepresident“ E. vorstand, als eine von drei Abteilungsleitern beschäftigt. Im September 2005 wurde die Stelle des E. frei. Die Beklagte besetzte diese mit einem Mann und nicht mit der damals schwangeren Klägerin. Diese begehrt die Zahlung einer Entschädigung wegen Benachteiligung aufgrund ihres Geschlechts. Sie habe die Stelle wegen ihrer Schwangerschaft nicht erhalten. Bei der Bekanntgabe dieser Entscheidung sei sie auf ihre Schwangerschaft angesprochen worden. Die Beklagte behauptet, für die getroffene Auswahl sprächen sachliche Gründe.
Das Arbeitsgericht hat der Klage stattgegeben. Das Landesarbeitsgericht hatte sie zunächst abgewiesen. Der Achte Senat des Bundesarbeitsgerichts hatte die Entscheidung des Landesarbeitsgerichts aufgehoben und die Sache an dieses zurückverwiesen. Er hatte angenommen, die Klägerin habe Tatsachen vorgetragen, die ihre geschlechtsspezifische Benachteiligung nach § 611a Abs. 1 BGB (gültig bis 17. August 2006) vermuten lassen könnten. Bei seiner erneuten Entscheidung hat das Landesarbeitsgericht nach Beweisaufnahme angenommen, dass auch die weiteren von der Klägerin vorgetragenen Tatsachen keine Vermutung für eine Benachteiligung wegen ihres Geschlechts bei der Beförderungsentscheidung begründen. Es hat die Klage wiederum abgewiesen. Auf die Revision der Klägerin hat der Achte Senat des Bundesarbeitsgerichts die Entscheidung des Landesarbeitsgerichts erneut aufgehoben und die Sache wieder zur neuen Verhandlung und Entscheidung an das Landesarbeitsgericht zurückverwiesen, weil dem Landesarbeitsgericht bei der Tatsachenfeststellung und bei der Verneinung der Vermutung einer Benachteiligung der Klägerin Rechtsfehler unterlaufen sind.
Bundesarbeitsgericht, Urteil vom 27. Januar 2011 – 8 AZR 483/09 -
Vorinstanz: Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg, Urteil vom 12. Februar 2009 – 2 Sa 2070/08 -
Pressemitteilung Nr. 11/11 vom 27.01.2011 auf www.bundesarbeitsgericht.de