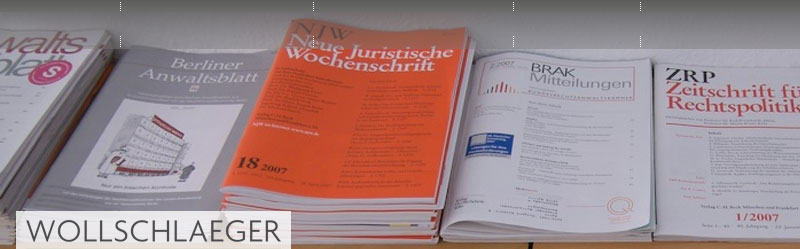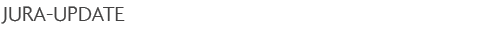Kündigungsbeschränkung bei Wohnungsumwandlung nur für Eigenbedarfs- und Verwertungskündigungen
12. März 2009Der unter anderem für das Wohnraummietrecht zuständige VIII. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat entschieden, dass die Sperrfristen des § 577a BGB* nach Wohnungsumwandlung nicht zur Anwendung gelangen, wenn die Kündigung eines Wohnraummietverhältnisses erfolgt, weil die Wohnung für eine Betreuungsperson benötigt wird, die nicht dem Haushalt des Vermieters angehört.
Die Klägerinnen sind seit dem 1. August 1999 Mieterinnen einer Wohnung in einem in München gelegenen Anwesen. Der vormalige Erwerber wandelte am 19. April 2002 das Anwesen in Wohnungs- und Teileigentum um. Die von den Klägerinnen gemietete Wohnung wurde am 25. Juli 2002 von der Beklagten erworben, die mit ihrer Familie in der Nachbarwohnung lebt. Mit Schreiben vom 31. Juli 2006 erklärte die Beklagte die Kündigung des Mietverhältnisses mit der Begründung, sie benötige die Wohnung der Klägerinnen zur Unterbringung einer Betreuungs- und Pflegeperson – eines “Au-pair-Mädchens” – für ihre beiden minderjährigen Kinder und ihre in ihrem Haushalt lebende Schwiegermutter.
Das Amtsgericht hat die auf Räumung der Wohnung gerichtete Widerklage der Beklagten abgewiesen. Das Berufungsgericht hat die Berufung der Beklagten zurückgewiesen. Die vom Berufungsgericht zugelassene Revision der Beklagten hatte Erfolg.
Der Bundesgerichtshof hat entschieden, dass die Kündigung der Beklagten nicht durch die zehnjährige Sperrfrist des § 577a Abs. 2 BGB (in Verbindung mit der einschlägigen Landesverordnung über die Gebiete mit gefährdeter Wohnungsversorgung) ausgeschlossen war. Gemäß § 577a BGB kann sich, wenn an den vermieteten Wohnräumen – wie in dem zu entscheidenden Fall – nach der Überlassung an den Mieter Wohnungseigentum begründet und das Wohnungseigentum veräußert worden ist, der Erwerber innerhalb der Sperrfrist nicht darauf berufen, dass er die Räume als Wohnung für sich, seine Familienangehörigen oder Angehörige seines Haushalts benötigt (§ 573 Abs. 2 Nr. 2 BGB) oder dass er durch die Fortsetzung des Mietverhältnisses an einer angemessenen wirtschaftlichen Verwertung des Grundstücks gehindert und dadurch erhebliche Nachteile erleiden würde (§ 573 Abs. 2 Nr. 3 BGB). Da das Au-pair-Mädchen nach den in der Revisionsinstanz nicht angegriffenen tatrichterlichen Feststellungen nicht Angehörige des Haushalts der Beklagten war, lag eine Eigenbedarfskündigung im Sinne von § 573 Abs. 2 Nr. 2 BGB nicht vor. Die Beklagte konnte aber nach den Feststellungen der Vorinstanzen ein berechtigtes Interesse an der Beendigung des Mietverhältnisses gemäß § 573 Abs. 1 Satz 1 BGB geltend machen.
Für eine darauf gestützte Kündigung gelten die Sperrfristen des § 577a BGB nicht. Mit dieser Vorschrift wollte der Gesetzgeber den Mieter besonders davor schützen, dass umgewandelte Eigentumswohnungen häufig zur Befriedigung eigenen Wohnbedarfs erworben werden. Dieses gesetzgeberische Ziel lässt sich nicht ohne weiteres auf andere Kündigungsgründe im Sinne von § 573 Abs. 1 Satz 1 BGB übertragen. Dass ein Vermieter ein berechtigtes Interesse an einer Kündigung hat, weil er die Wohnung – wie hier – zur Unterbringung einer Hausangestellten benötigt, ist nicht in demselben Maß wahrscheinlich wie ein Eigenbedarf des Erwerbers nach Umwandlung in Wohnungseigentum und birgt deshalb auch nicht dieselbe Gefahr einer Verdrängung des Mieters. Daher ist die Beschränkung des Anwendungsbereichs des § 577a BGB durch den Gesetzgeber auf die Fälle der Eigenbedarfs- und der Verwertungskündigung zu respektieren und scheidet eine analoge Anwendung der Vorschrift aus, weil keine Gesetzeslücke besteht BGH, Urteil vom 11. März 2009 – VIII ZR 127/08).
Vorinstanzen: AG München, Urteil vom 23. März 2007 – 473 C 36952/06; LG München, Urteil vom 23. April 2008 – 14 S 7911/07
Quelle: Pressemitteilung Nr. 57/09 vom 11.03.2009 auf www.bundesgerichtshof.de
*§ 577a Kündigungsbeschränkung bei Wohnungsumwandlung
(1) Ist an vermieteten Wohnräumen nach der Überlassung an den Mieter Wohnungseigentum begründet und das Wohnungseigentum veräußert worden, so kann sich ein Erwerber auf berechtigte Interessen im Sinne des § 573 Abs. 2 Nr. 2 oder 3 erst nach Ablauf von drei Jahren seit der Veräußerung berufen.
(2) Die Frist nach Absatz 1 beträgt bis zu zehn Jahre, wenn die ausreichende Versorgung der Bevölkerung mit Mietwohnungen zu angemessenen Bedingungen in einer Gemeinde oder einem Teil einer Gemeinde besonders gefährdet ist und diese Gebiete nach Satz 2 bestimmt sind. Die Landesregierungen werden ermächtigt, diese Gebiete und die Frist nach Satz 1 durch Rechtsverordnung für die Dauer von jeweils höchstens zehn Jahren zu bestimmen.