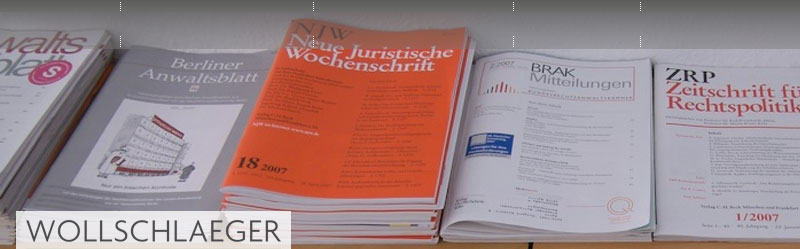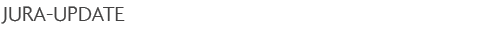In drei heute verkündeten Entscheidungen hat sich der u. a. für das Markenrecht zuständige I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs mit der kennzeichenrechtlichen Beurteilung der Verwendung fremder Kennzeichen als Schlüsselwörter (Keywords) im Rahmen der von der Suchmaschine Google eröffneten Möglichkeit der Werbung mit sog. AdWord-Anzeigen befasst. In zwei Sachen hat der Bundesgerichtshof Ansprüche der Kennzeicheninhaber verneint, in der dritten Sache hat er dem Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften (EuGH) eine Frage zur Auslegung der Markenrechtsrichtlinie vorgelegt.
In den Verfahren ging es um die in der Instanzrechtsprechung unterschiedlich beurteilte Frage, ob es eine Kennzeichenverletzung darstellt, wenn ein Dritter ein fremdes Kennzeichen (also eine Marke oder eine Unternehmensbezeichnung) oder eine dem geschützten Zeichen ähnliche Bezeichnung einem Suchmaschinenbetreiber gegenüber als Schlüsselwort angibt mit dem Ziel, dass bei der Eingabe dieser Bezeichnung als Suchwort in die Suchmaschine in einem von der Trefferliste räumlich getrennten Werbeblock eine als solche gekennzeichnete Anzeige des Dritten (mit Link auf dessen Website) als Werbung für seine Waren oder Dienstleistungen erscheint. In den entschiedenen Fällen enthielt die Anzeige weder das als Suchwort verwendete fremde Zeichen noch sonst einen Hinweis auf den Kennzeicheninhaber oder auf die von diesem angebotenen Produkte.
Im ersten Verfahren – I ZR 125/07 – hatte die beklagte Anbieterin von Erotikartikeln gegenüber Google das Schlüsselwort “bananabay” angegeben. “Bananabay” ist für die Klägerin, die unter dieser Bezeichnung ebenfalls Erotikartikel im Internet vertreibt, als Marke geschützt. Ist eine als Schlüsselwort benutzte Bezeichnung – wie in diesem Fall – mit einer fremden Marke identisch und wird sie zudem für Waren oder Dienstleistungen benutzt, die mit denjenigen identisch sind, für die die fremde Marke Schutz genießt, hängt die Annahme einer Markenverletzung in einem solchen Fall nur noch davon ab, ob in der Verwendung der geschützten Bezeichnung als Schlüsselwort eine Benutzung als Marke im Sinne des Markengesetzes liegt. Da die Bestimmungen des deutschen Rechts auf harmonisiertem europäischen Recht beruhen, hat der Bundesgerichtshof das Verfahren ausgesetzt, um dem Europäischen Gerichtshof diese Frage zur Vorabentscheidung nach Art. 234 EG-Vertrag vorzulegen.
Im zweiten Verfahren – I ZR 139/07 – standen sich zwei Unternehmen gegenüber, die über das Internet Leiterplatten anbieten. Für die Klägerin ist die Marke “PCB-POOL” geschützt. Der Beklagte hatte bei Google als Schlüsselwort die Buchstaben “pcb” angemeldet, die von den angesprochenen Fachkreisen als Abkürzung für “printed circuit board” (englisch für Leiterplatte) verstanden werden. Die Adword-Anmeldung von “pcb” hatte zur Folge, dass auch bei Eingabe von “PCB-POOL” in die Suchmaschine von Google in dem gesonderten Anzeigenblock neben der Trefferliste eine Anzeige für Produkte des Beklagten erschien. Der Bundesgerichtshof hat in diesem Fall die Klage unter Aufhebung des Berufungsurteils abgewiesen. Der Markeninhaber kann in der Regel die Verwendung einer beschreibenden Angabe (hier “pcb”) auch dann nicht untersagen, wenn sie markenmäßig benutzt und dadurch die Gefahr einer Verwechslung mit der geschützten Marke begründet wird. Der Bundesgerichtshof hat in diesem Fall eine markenrechtlich erlaubte beschreibende Benutzung angenommen. Da eine Kennzeichenverletzung schon aus diesem Grund zu verneinen war, kam es auf die in dem Verfahren I ZR 125/07 dem Europäischen Gerichtshof vorgelegte Rechtsfrage nicht mehr an.
Am dritten Verfahren – I ZR 30/07 – war ebenfalls die Klägerin des zweiten Verfahrens – sie führt die Unternehmensbezeichnung “Beta Layout GmbH” – beteiligt. Hier ging es darum, dass ein anderer Wettbewerber bei Google als Schlüsselwort die Bezeichnung “Beta Layout” anmeldet hatte. Auch in diesem Fall erschien immer dann, wenn ein Internetnutzer bei Google als Suchwort “Beta Layout” eingab, neben der Trefferliste ein Anzeigenblock mit einer Anzeige für die Produkte des Wettbewerbers. In diesem Fall hat der Bundesgerichtshof die Entscheidung des Berufungsgerichts bestätigt, das eine Verletzung der Unternehmensbezeichnung und einen entsprechenden Unterlassungsanspruch mit der Begründung verneint hatte, es fehle an der für die Verletzung der Unternehmensbezeichnung erforderlichen Verwechslungsgefahr. Der Internetnutzer nehme nicht an, dass die in dem gesonderten Anzeigenblock neben der Trefferliste erscheinende Anzeige von der Beta Layout GmbH stamme. Diese tatrichterliche Feststellung des Verkehrsverständnisses war nach Auffassung des Bundesgerichtshofs nicht zu beanstanden. Da der Schutz der Unternehmensbezeichnungen anders als der Markenschutz nicht auf harmonisiertem europäischem Recht beruht, kam in diesem Verfahren eine Vorlage an den Europäischen Gerichtshof nicht in Betracht.
Beschluss vom 22. Januar 2009 – I ZR 125/07 – Bananabay
LG Braunschweig – Urteil vom 7. März 2007 – 9 O 2382/06
OLG Braunschweig – Urteil vom 12. Juli 2007 – 2 U 24/07 – MMR 2007, 789
Urteil vom 22. Januar 2009 – I ZR 139/07 – pcb
LG Stuttgart – Urteil vom 13. März 2007 – 41 O 189/06
OLG Stuttgart – Urteil vom 9. August 2007 – 2 U 23/07 – WRP 2007, 649
Urteil vom 22. Januar 2009 – I ZR 30/07 – Beta Layout
LG Düsseldorf – Urteil vom 7. April 2006 – 34 O 179/05
OLG Düsseldorf – Urteil vom 23. Januar 2007 – 20 U 79/06 – WRP 2007, 440
Quelle: Pressemitteilung Nr. 17/09 vom 22.01.2009 auf www.bundesgerichtshof.de