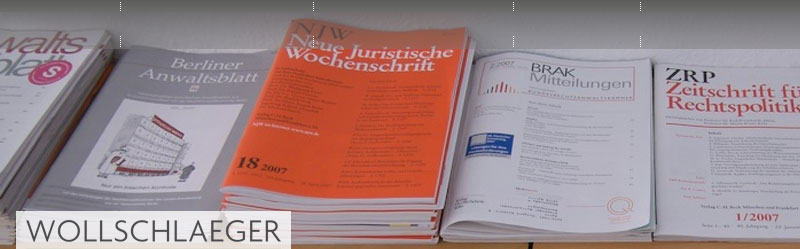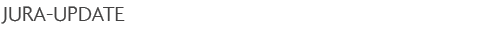Haftung des Architekten für unrichtige Bautenstandsberichte
29. September 2008
Der für das Werkvertragsrecht zuständige VII. Zivilsenat hat entschieden, dass den Erwerbern einer noch zu errichtenden Eigentumswohnung Schadensersatzansprüche gegen den vom Veräußerer mit der Bauleitung beauftragten Architekten zustehen können, wenn dieser unrichtige Bautenstandsberichte erstellt hat, die vereinbarungsgemäß Grundlage für die ratenweise Zahlung des Erwerbspreises sein sollen. Die Kläger haben von S. eine auf der Grundlage einer konkreten Baugenehmigung noch zu errichtende Wohnung erworben. Der Erwerbspreis war in acht Raten zu bezahlen. Die für die Fälligkeit ab der zweiten Rate erforderlichen Bautenstandsberichte waren im Auftrag des S. von dem beklagten Architekten, dem unter anderem die Bauaufsicht übertragen war, zu erstellen. Der Beklagte hat gegenüber der den Erwerbspreis finanzierenden Bank verbindlich erklärt, der verantwortliche Bauleiter des Bauvorhabens zu sein und bestätigt, dass das Bauvorhaben nach den genehmigten Bauplänen errichtet werden solle. Der Beklagte hat sieben Bautenstandsberichte gefertigt. Die Kläger haben den Beklagten haben gesamtschuldnerisch mit S. auf Schadensersatz verklagt. Sie machen geltend, der Beklagte habe in den Bautenstandsberichten trotz entsprechender Kenntnis weder auf Mängel noch auf die nicht der Baugenehmigung entsprechende Ausführung des Bauvorhabens hingewiesen. Seine unrichtigen Bautenstandsberichte seien Grundlage für die Auszahlung der Raten durch die finanzierende Bank gemäß dem Zahlungsplan gewesen. Hätte der Beklagte die Bautenstandsberichte zutreffend erstellt, hätten sie nach der ersten Rate keine weiteren Zahlungen auf den Erwerbspreis erbracht. Das Landgericht hat den Beklagten zur Zahlung von Schadensersatz verurteilt. Das Oberlandesgericht hat auf die Berufung des Beklagten die Klage abgewiesen. Auf die Revision der Kläger hat der Senat dieses Urteil aufgehoben und den Rechtsstreit an das Berufungsgericht zurückverwiesen. Entgegen dessen Auffassung kann den Klägern gegen den Beklagten ein Schadensersatzanspruch zustehen, wenn der Beklagte schuldhaft unrichtige Bautenstandsberichte erstellt und dadurch von den Klägern nicht geschuldete Zahlungen auf den Erwerbspreis veranlasst hat. Die Kläger sind in den Schutzbereich des zwischen dem Beklagten und S. abgeschlossenen Architektenvertrags einbezogen. Der Beklagte hatte den Bautenstand jeweils als Grundlage für die einzelnen Ratenzahlungen zu bescheinigen. Die Bautenstandsberichte waren zumindest auch dazu bestimmt sicherzustellen, dass Ratenzahlungen nur erfolgten, wenn der für deren Fälligkeit vereinbarte vertragsgemäße Bautenstand erreicht war. Das Berufungsgericht wird daher nach Zurückverweisung der Sache zu prüfen haben, ob und inwieweit die einzelnen Bautenstandsberichte vorwerfbar fehlerhaft erstellt und die Fehler für die Auszahlung der Beträge nach dem Zahlungsplan kausal geworden sind (BGH, Urteil vom 25. September 2008 – VII ZR 35/07).
Vorinstanzen: Landgericht Itzehoe – Urteil vom 27. Juni 2003 – 3 O 17/01; Schleswig-Holsteinisches Oberlandesgericht – Urteil vom 1. Februar 2007 –7 U 86/03
Quelle: Pressemitteilung Nr. 182/08 vom 25.09.2008 auf www.bundesgerichtshof.de