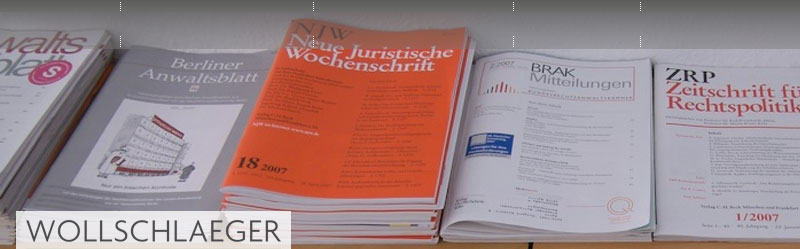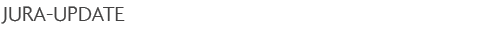Der Kläger ist der Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände. Der Beklagte unterhält das Kundenbindungs- und Rabattsystem “Payback”. Der Kläger nimmt den Beklagten im Wesentlichen auf Unterlassung der Verwendung dreier Klauseln in Anspruch, die dieser in Papierformularen verwendet, mit denen sich Verbraucher zur Teilnahme am Rabattprogramm anmelden können. Das Berufungsgericht hat die Verwendung der Klauseln nicht beanstandet.
Die vom Berufungsgericht zugelassene Revision des Klägers hatte zum Teil Erfolg. Mit seinem heute verkündeten Urteil hat der unter anderem für das Kaufrecht zuständige VIII. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs eine vom Beklagten verwendete Klausel, die die Einwilligung in die Speicherung und Nutzung von Daten für die Zusendung von Werbung per Post, E-Mail und SMS betrifft, für unwirksam erklärt, soweit sie E-Mail und SMS betrifft (§ 307 Abs. 1 Satz 1, Abs. 2 Nr. 1 BGB). Eine Klausel, wonach die Angabe des Geburtsdatums für die Teilnahme am “Payback”-Programm benötigt werde, sowie eine Formularbestimmung, die die Meldung der Rabattdaten für die Verwaltung und Auszahlung der Rabatte zum Gegenstand hat, hat der Bundesgerichtshof nicht beanstandet, weil sie keine von Rechtsvorschriften abweichenden Regelungen enthalten (§ 307 Abs. 3 Satz 1 BGB).
Die mit “Einwilligung in Werbung und Markforschung” überschriebene Einwilligungsklausel lautet:
“Mit meiner Unterschrift erkläre ich mich einverstanden, dass die von mir oben angegebenen Daten sowie die Rabattdaten (Waren/Dienstleistungen, Preis, Rabattbetrag, Ort und Datum des Vorgangs) für an mich gerichtete Werbung (z. B. Informationen über Sonderangebote, Rabattaktionen) per Post und mittels ggfs. von mir beantragter Services (SMS oder E-Mail-Newsletter) sowie zu Zwecken der Marktforschung ausschließlich von der L. Partner GmbH und den Partnerunternehmen gemäß Nummer 2 der beiliegenden Hinweise zum Datenschutz gespeichert und genutzt werden. …
? Hier ankreuzen, falls die Einwilligung nicht erteilt wird. …”
Die verwendete Klausel unterscheidet zwischen Werbung per Post, E-Mail und SMS. Im Hinblick auf die Einwilligung in die Speicherung und Nutzung von Daten für die Zusendung von Werbung per Post war die Bestimmung an den §§ 4 Abs. 1, 4a Abs. 1 des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) zu messen, die besondere Voraussetzungen für die Zulässigkeit der Datenerhebung, -verarbeitung und -nutzung aufstellen. Der Bundesgerichtshof hat entschieden, dass die Einwilligungsklausel unter diesem Gesichtspunkt nicht zu beanstanden ist. Aus § 4a BDSG ergibt sich insbesondere nicht, dass die Einwilligung nur dann wirksam sein soll, wenn sie in der Weise “aktiv” erklärt wird, dass der Verbraucher eine gesonderte Einwilligungserklärung unterzeichnen oder ein für die Erteilung der Einwilligung vorzusehendes Kästchen ankreuzen muss (“Opt-in”-Erklärung). Vielmehr folgt aus § 4a Abs. 1 Satz 4 BDSG,* dass die Einwilligung auch zusammen mit anderen Erklärungen schriftlich erteilt werden kann, sofern sie – wie hier – besonders hervorgehoben wird.
Dagegen ist die hier verwendete Einwilligungsklausel unwirksam, soweit sie sich auf die Einwilligung in die vom Beklagten erstrebte Datennutzung für Werbung durch E-Mail oder SMS bezieht. Insoweit greift zusätzlich das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG) ein. Nach § 7 Abs. 2 Nr. 3 UWG** stellt unter anderem Werbung unter Verwendung elektronischer Post (E-Mail und SMS) eine unzumutbare Belästigung dar, sofern keine Einwilligung des Adressaten vorliegt. Der VIII. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat – in Abstimmung mit dem für Rechtsstreitigkeiten über Ansprüche aus dem Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb zuständigen I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs – entschieden, dass Einwilligungsklauseln, die so gestaltet sind, dass der Kunde tätig werden und ein Kästchen ankreuzen muss, wenn er seine Einwilligung in die Zusendung von Werbung unter Verwendung von elektronischer Post nicht erteilen will (“Opt-out”-Erklärung), mit dieser Vorschrift nicht vereinbar sind. § 7 Abs. 2 Nr. 3 UWG verlangt, dass die Einwilligung durch eine gesonderte Erklärung erteilt wird (“Opt-in”-Erklärung). Das Erfordernis einer gesonderten Erklärung ergibt sich aus der EG-Datenschutzrichtlinie für elektronische Kommunikation (2002/58/EG), die der deutsche Gesetzgeber mit der Regelung des § 7 UWG umsetzen wollte. Nach dieser Richtlinie kann die Einwilligung in jeder geeigneten Weise gegeben werden, durch die der Wunsch des Nutzers in einer “spezifischen Angabe” zum Ausdruck kommt. Diese Formulierung macht deutlich, dass eine gesonderte, nur auf die Einwilligung in die Zusendung von Werbung mittels elektronischer Post bezogene Zustimmungserklärung des Betroffenen erforderlich ist. Eine solche Erklärung ist nicht schon in der Unterschrift zu sehen, mit der der Kunde das auf Rabattgewährung gerichtete Vertragsangebot annimmt.
Eine gesonderte Einwilligungserklärung sieht das von dem Beklagten verwendete Anmeldeformular nicht vor. Der Verbraucher kann in dem Formular zwar seine E-Mail-Adresse oder Mobilfunknummer angeben. Damit willigt er nach der Formulargestaltung aber nur in die elektronische Information über “Extra-Punktechancen, Top-Aktionen und Neuigkeiten zu Payback …” ein, nicht aber in die Zusendung von Werbung jeglicher Art durch elektronische Post.
2. Die zweite, vom Kläger allerdings ohne Erfolg angegriffene Klausel sieht vor:
“Wenn Sie am Payback Programm teilnehmen, werden … Ihr Geburtsdatum … benötigt. …”
Der Bundesgerichtshof hat entschieden, dass diese Bestimmung gemäß § 307 Abs. 3 Satz 1 BGB nicht der Inhaltskontrolle unterliegt. Die Angabe des Geburtsdatums dient der Zweckbestimmung des Vertrags des Beklagten mit dem Verbraucher (§ 28 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 Alt. 1 BDSG).*** Schon angesichts der Vielzahl der Teilnehmer am Payback-Programm gehört eine praktikable und gleichzeitig sichere Methode der Identifizierung der Programmteilnehmer zu den Vertragszwecken. Die Angabe des vollständigen Geburtsdatums ist bei einem Bonusprogramm, welches nach den Feststellungen des Berufungsgerichts rund dreißig Millionen Teilnehmer hat, zur Vermeidung von Identitätsverwechslungen in besonderer Weise geeignet.
3. Die dritte Klausel, die Gegenstand des Revisionsverfahrens war, lautet:
“Setzen Sie Ihre Payback-Karte bei einem Partnerunternehmen ein, so meldet dieses die Rabattdaten (Waren/Dienstleistungen …) an L. Partner zur Gutschrift, Abrechnung gegenüber den Partnerunternehmen, Verwaltung und Auszahlung der Rabatte.”
Der Bundesgerichtshof hat die Auffassung des Berufungsgerichts bestätigt, dass auch diese Formularbestimmung nicht der Inhaltskontrolle unterliegt (§ 307 Abs. 3 Satz 1 BGB). Die Mitteilung der Rabattdaten durch das Partnerunternehmen dient, auch soweit es um eine Mitteilung der von den Teilnehmern unter Einsatz der Payback-Karte erworbenen Waren und Dienstleistungen geht, ebenfalls der Zweckbestimmung des Vertragsverhältnisses des Beklagten mit den Teilnehmern des Rabatsystems (§ 28 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 Alt. 1 BDSG). Die dem Bonusprogramm angeschlossenen Partnerunternehmen können von einer Vielzahl unterschiedlicher Rabattierungsmöglichkeiten Gebrauch machen, die speziell von der jeweiligen Ware bzw. Dienstleistung abhängen können. Angesichts dessen bedarf der Beklagte der Kenntnis der vom Kunden bei dem Partnerunternehmen erworbenen Waren bzw. in Anspruch genommenen Dienstleistungen, um den Kunden über deren Punktestand vollständig, richtig, verständlich und nachprüfbar Auskunft geben zu können.
* § 4a Abs. 1 Satz 4 BDSG lautet: “Soll die Einwilligung zusammen mit anderen Erklärungen schriftlich erteilt werden, ist sie besonders hervorzuheben.”
** § 7 Abs. 2 Nr. 3 UWG bestimmt: “Eine unzumutbare Belästigung ist insbesondere anzunehmen bei einer Werbung unter Verwendung von automatischen Anrufmaschinen, Faxgeräten oder elektronischer Post, ohne dass eine Einwilligung der Adressaten vorliegt.”
*** § 28 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 BDSG regelt: “Das Erheben, Speichern, Verändern oder Übermitteln personenbezogener Daten oder ihre Nutzung als Mittel für die Erfüllung eigener Geschäftszwecke ist zulässig, wenn es der Zweckbestimmung eines Vertragsverhältnisses … mit dem Betroffenen dient.”
Urteil vom 16. Juli 2008 – VIII ZR 348/06
Quelle: Pressemitteilung des Bundesgerichtshofes Nr. 135/08 vom 16.07.2008 unter www.bundesgerichtshof.de