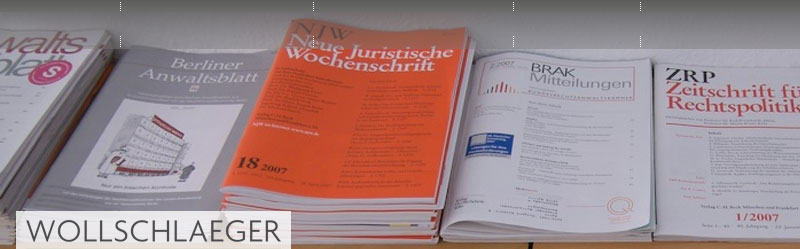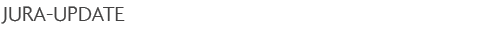Bundesgerichtshof entscheidet erneut über die Veröffentlichung eines Bildes von Caroline Prinzessin von Hannover
2. Juli 2008Die Klägerin, Caroline Prinzessin von Hannover, hat sich gegen die Veröffentlichung eines Fotos in der von dem Beklagten verlegten Zeitschrift gewandt. Diese hatte einen Artikel über die Vermietung einer Ferienvilla des Ehemannes der Klägerin auf einer Insel vor Kenia veröffentlicht, der u. a. mit einer Aufnahme dieser beiden Personen bebildert war. Die Fotografie ist während eines Urlaubsaufenthalts der Abgebildeten entstanden und zeigt die Personen auf belebter Straße. Die Klägerin begehrt Unterlassung der erneuten Veröffentlichung der beanstandeten Aufnahme.
Das Landgericht hat der Klage im Hinblick auf das Urteil des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte vom 24. Juni 2004 stattgegeben. Auf die Berufung der Beklagten hat das Oberlandesgericht die Klage abgewiesen, weil nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts der Schutz der Privatsphäre der Abgebildeten hinter das mit der Pressefreiheit verwirklichte Informationsinteresse der Allgemeinheit zurücktrete, wenn die veröffentlichte Aufnahme die abgebildete Person in der Öffentlichkeit zeige. Der Bundesgerichtshof hat auf die Revision der Klägerin mit Urteil vom 6. März 2007 das Urteil des Oberlandesgerichts aufgehoben und die Berufung der Beklagten zurückgewiesen. Das Bundesverfassungsgericht hat dieses Urteil aufgehoben und die Sache an den Bundesgerichtshof zurückverwiesen. Es hat eine nähere Würdigung des Berichts, dem die Aufnahme beigefügt war, im Hinblick auf dessen Informationsgehalt vermisst. Der Bericht über die Vermietung der Villa an Dritte sei mit wertenden Anmerkungen versehen, die Anlass für sozialkritische Überlegungen der Leser sein könnten. Das könne Anlass für eine die Allgemeinheit interessierende Sachdebatte. geben und es grundsätzlich rechtfertigen, die Vermieter des in dem Beitrag behandelten Anwesens im Bild darzustellen.
Der u. a. für Fragen der Verletzung des allgemeinen Persönlichkeitsrechts zuständige VI. Zivilsenat hat nunmehr die Klage abgewiesen. Als Ergebnis der gebotenen erneuten Abwägung zwischen den Rechten der Klägerin und der Pressefreiheit der Beklagten entsprechend den vom Bundesverfassungsgericht in seinem Beschluss aufgestellten Grundsätzen müsse das Persönlichkeitsrecht der Klägerin zurückstehen. Das mit der Pressefreiheit geschützte Informationsinteresse der Öffentlichkeit erscheine gewichtiger. Der von der Klägerin inhaltlich nicht beanstandete Artikel befasse sich – wie das Bundesverfassungsgericht dargelegt habe – damit, dass auch “die Reichen und Schönen” ein gewandeltes Konsumverhalten zeigten und nicht genutzte Immobilien vermieteten, hier für 1.000 US-Dollar täglich. Das könne zu einer Debatte von öffentlichem Interesse führen. Dies gestatte die Beifügung des Fotos der Klägerin auch ohne deren Einwilligung (BGH, Urteil vom 1. Juli 2008 – VI ZR 67/08).
Quelle: Pressemitteilung Nr. 126/08 vom 01.07.2008 auf www.bundesgerichtshof.de