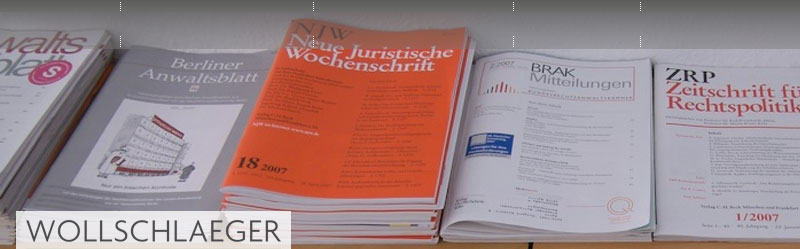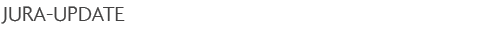15. November 2007
Schließt ein Arbeitnehmer mit seinem Arbeitgeber einen schriftlichen Geschäftsführerdienstvertrag, wird vermutet, dass das bis dahin bestehende Arbeitsverhältnis mit Beginn des Geschäftsführerdienstverhältnisses einvernehmlich beendet wird, soweit nicht klar und eindeutig etwas anderes vertraglich vereinbart worden ist. Durch einen schriftlichen Geschäftsführerdienstvertrag wird in diesen Fällen das Schriftformerfordernis des § 623 BGB für den Auflösungsvertrag gewahrt. (BAG – Urteil vom 19.7.2007, 6 AZR 774/06; siehe auch BAG – Urteil vom 19.7.2007, 6 AZR 875/06)
Quelle: www.bundesarbeitsgericht.de
Kategorie Arbeitsrecht
12. Oktober 2007
Der Bundesgerichtshof (Urteil vom 12. April 2007 – VII ZR 122/06) hat entschieden, dass eine Widerrufsbelehrung, die den Verbraucher lediglich über dessen Pflichten im Falle des Widerrufs, nicht jedoch über dessen wesentliche Rechte informiert, nicht den Anforderungen des Gesetzes genügt. Die wesentlichen Rechte des Verbrauchers ergeben sich daraus, dass nach dem Widerruf das gesetzliche Rücktrittsrecht anwendbar ist. Dazu gehört das Recht des Verbrauchers, vom Unternehmer geleistete Zahlungen und auch Zinsen zu verlangen.
Ohne ausreichende Widerrufsbelehrung beginnt der Lauf der zweiwöchigen Widerrufsfrist nicht.
Quelle: Entscheidung des BGH unter www.bundesgerichtshof.de
Kategorie Allgemein, Gewerblicher Rechtsschutz
12. Oktober 2007
Eine in Allgemeinen Geschäftsbedingungen eines Wohnraummietvertrages enthaltene Regelung, die dem Mieter die Verpflichtung zur Ausführung der Schönheitsreparaturen auferlegt und bestimmt, dass der Mieter nur mit Zustimmung des Wohnungsunternehmens von der “bisherigen Ausführungsart” abweichen darf, ist auch dann insgesamt – und nicht nur hinsichtlich der Ausführungsart – wegen unangemessener Benachteiligung des Mieters unwirksam, wenn die Verpflichtung als solche und ihre inhaltliche Ausgestaltung in zwei verschiedenen Klauseln enthalten sind (BGH, Urteil vom 28. März 2007 -VIII ZR 199/06).
Quelle: Entscheidung des BGH unter www.bundesgerichtshof.de
Kategorie Miet- und Immobilienrecht
12. Oktober 2007
Durch Urteil vom 26. September 2007, Az. VIII ZR 143/06 -Pressemitteilung Nr. 137/07, hat der Bundesgerichtshof unter Fortführung seiner bisherigen Rechtsprechung entschieden, dass auch eine Quotenabgeltungsklausel, die die Beachtung des tatsächlichen bzw. zu erwartenden Renovierungsbedarfs ermöglicht (Quotenabgeltungsklauseln mit “flexibler” Abgeltungsquote) im Einzelfall deshalb unwirksam sein kann, weil sie dem durchschnittlichen Mieter nicht hinreichend klar und verständlich macht, wie die Abgeltungsquote konkret zu berechnen ist, und damit gegen das in § 307 Abs. 1 Satz 1 und 2 BGB normierte Transparenzgebot verstößt.
In dem dem der Entscheidung zugrunde liegenden Fall waren die Mieter nach dem Mietvertrag Kläger verpflichtet, Schönheitsreparaturen während der Mietzeit regelmäßig nach Ablauf näher bestimmter, nach Nutzungsart der Räume gestaffelter Fristen von drei, fünf bzw. sieben Jahren auszuführen. Davon konnte abgewichen werden, wenn der Zustand der Räume eine Einhaltung der Frist nicht erfordert. Die streitgegenständliche Quotenabgeltungsklausel lautete:
“Sind bei Beendigung des Mietvertrags die Schönheitsreparaturen [...] nicht fällig, so zahlt der Mieter an den Vermieter einen Kostenersatz für die seit der letzten Durchführung der Schönheitsreparaturen erfolgte Abwohnzeit im Fristenzeitraum [...], sofern nicht der Mieter die Schönheitsreparaturen durchführt oder sich nicht der unmittelbar folgende Nachmieter zur Durchführung von Schönheitsreparaturen bereiterklärt oder die Kosten hierfür übernimmt.
Die Höhe dieses Kostenersatzes wird anhand eines Kostenvoranschlages eines von den Vertragsparteien ausgewählten Fachbetriebes des Malerhandwerks über die üblicherweise bei der Renovierung der Mieträume anfallenden Schönheitsreparaturen ermittelt. Sie entspricht dem Verhältnis der [...] festgesetzten Fristen für die Durchführung der Schönheitsreparaturen und der Wohndauer seit den zuletzt durchgeführten Schönheitsreparaturen.”
Quelle: Entscheidung des BGH unter www.bundesgerichtshof.de
Kategorie Miet- und Immobilienrecht
14. September 2007
Beschäftigten, die Material des Arbeitgebers entwenden und anschließend bei eBay verkaufen, darf fristlos gekündigt werden. Dies gilt auch, wenn der Diebstahl nicht hundertprozentig aufgeklärt werden kann und der Arbeitnehmer mehr als 30 Jahre im Betrieb beschäftigt ist (LAG Köln, Urteil vom 16.1.2007 – Az. 9 Sa 1033/06).
Quelle: www.kanzlei-prof-schweizer.de/bibliothek/urteile/index.html?id=13697
Kategorie Arbeitsrecht
31. August 2007
Entsteht nach Abschluss des Mietvertrages über Gewerberäume eine vertragswidrige Konkurrenzsituation, in dem der Vermieter selbst in 5 Metern Abstand vom Mietobjekt einen Gewerbebetrieb betreibt, liegt ein zur Minderung des Mietzinses berechtigender Sachmangel vor. (Kammergericht Berlin, Urteil vom 16.04.2007 – 8 U 199/06)
Quelle: Entscheidungen des Kammergerichts Berlin unter www.kammergericht.de
Kategorie Miet- und Immobilienrecht
24. August 2007
Führt ein Unternehmen, das bei einer Auftragsneuvergabe berücksichtigt wurde, die Erfüllung der Aufgabe eines Servicevertrages fort, so stellt dies für sich genommen keinen Betriebsübergang dar. Voraussetzung eines Betriebsübergangs ist, dass die wirtschaftliche Einheit im Wesentlichen unverändert unter Wahrung ihrer Identität fortgeführt wird. Daran fehlt es, wenn die Aufgabe künftig im Rahmen einer wesentlich anderen, deutlich größeren Organisationsstruktur durchgeführt wird, deren Aufgabenumfang zudem um ein Vielfaches größer ist.
Der Kläger war seit 1995 bei der CB GmbH beschäftigt, die mit etwa 20 Arbeitnehmern technische Dienstleistungen in einem Teilbereich des Klinikums C. erbrachte. Dafür benutzte sie Räume und Software des Klinikums; dieses zahlte Wasser und Elektrizität. Das Klinikum kündigte den Dienstleistungsauftrag gegenüber der CB GmbH zum 31. März 2006. Seit dem 1. April 2006 nimmt die CF GmbH die Aufgaben wahr. Diese beschäftigt ca. 1.900 Arbeitnehmer und nimmt für das gesamte Klinikum den technischen und kaufmännischen Service wahr.
Der Kläger begehrt die Feststellung, eine ihm zum 30. April 2006 ausgesprochene Kündigung sei unwirksam. Er meint, es liege ein Betriebsübergang auf die CF GmbH vor. Außerdem habe die CB GmbH ihren Betrieb gar nicht stillgelegt. Zudem habe sie eine notwendige Massenentlassungsanzeige unterlassen.
Das Arbeitsgericht hat die Klage abgewiesen. Das Landesarbeitsgericht hat ihr stattgegeben. Die Revision der CF GmbH war in vollem Umfang erfolgreich. Ein Betriebsübergang auf die CF GmbH liegt nicht vor. Ob die Kündigung der CB GmbH aus anderen Gründen unwirksam ist, muss das Landesarbeitsgericht noch weiter überprüfen. (BAG, Urteil vom 14. August 2007 – 8 AZR 1043/06)
Quelle: Entscheidung des BAG unter www.bundesarbeitsgericht.de
Kategorie Arbeitsrecht
24. August 2007
Der bedürftigen Partei ist es auch im Rahmen einer Änderung der Prozesskostenhilfebewilligung nach § 120 Abs. 4 ZPO zuzumuten, ein (durch den Zugewinnausgleich) erlangtes Vermögen für die Prozesskosten einzusetzen, selbst wenn sie damit ein angemessenes Hausgrundstück i.S. von § 90 Abs. 2 Nr. 8 SGB XII erworben hat (BGH, Beschluss vom 18. Juli 2007 – XII ZA 11/07; Fortführung von BGH Beschluss vom 21. September 2006 – IX ZB 305/05 – NJW-RR 2007, 628).
Quelle: Entscheidung des BGH unter www.bundesgerichtshof.de
Kategorie Allgemein
23. August 2007
Der arbeitsrechtliche Gleichbehandlungsgrundsatz ist unter anderem dann verletzt, wenn der Arbeitgeber gegen eine Norm verstößt, die eine Benachteiligung von Arbeitnehmern ausdrücklich verbietet. Ein solches Verbot enthielt § 611a BGB, der die Benachteiligung wegen des Geschlechts untersagte. Seit dem 18. August 2006 ist dieses Verbot im Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz geregelt.
Die Klägerin ist angestellte Lehrerin bei dem beklagten Verein. Über 90 % der Schüler des Beklagten sind Jungen. Neben der Klägerin beschäftigt der Beklagte eine weitere Lehrerin und vier Lehrer. Die Arbeitsverträge des Schulleiters und zweier weiterer männlicher Lehrkräfte sehen im Unterschied zu den Arbeitsverträgen der Klägerin und ihrer Kollegin sog. beamtenähnliche Leistungen wie Versorgungs- und Beihilfeleistungen, Reise- und Umzugskostenerstattungen vor. Der vierte Lehrer ist abgeordneter Landesbeamter.
Mit ihrer Klage hat die Klägerin den Abschluss eines „beamtenähnlichen“ Arbeitsvertrags entsprechend den Arbeitsverträgen ihrer drei männlichen angestellten Kollegen verlangt. Das Arbeitsgericht und das Landesarbeitsgericht haben die Klage abgewiesen. Die Revision der Klägerin hatte vor dem Bundesarbeitsgericht Erfolg. Die unterschiedliche Behandlung ist nicht durch einen sachlichen Grund gerechtfertigt. Der Beklagte hat ohne Erfolg geltend gemacht, er könne aus Kostengründen neben dem Schulleiter nur zwei Lehrkräfte beamtenähnlich behandeln. Das erklärt nicht, weshalb er die Klägerin nicht in die dann erforderliche Auswahl einbezogen hat. Auch ein hoher Jungenanteil rechtfertigt es nicht, bei der gebotenen Auswahlentscheidung ausschließlich auf das männliche Geschlecht abzustellen. (BAG, Urteil vom 14. August 2007 – 9 AZR 943/06)
Quelle: Entscheidung des BAG unter www.bundesarbeitsgericht.de
Kategorie Arbeitsrecht
12. August 2007
Verursacht ein Arbeitnehmer in Ausübung seiner Tätigkeit schuldhaft einen Schaden, gelten folgende Grundsätze: Der Arbeitnehmer haftet dem Arbeitgeber gegenüber bei bloß leicht fahrlässiger Schadensverursachung überhaupt nicht. Bei mittlerer Fahrlässigkeit ist der Schaden zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer aufzuteilen. Bei grober Fahrlässigkeit oder gar Vorsatz trifft den Arbeitnehmer grundsätzlich die volle Haftung.
Das Landesarbeitsgericht Hamm wendet diese, von der Rechtsprechung entwickelten Grundsätze der Haftungsprivilegierung im Arbeitsverhältnis nur im Verhältnis des Arbeitnehmers zum Arbeitgeber an. Arbeitnehmer untereinander haften dagegen in der Regel uneingeschränkt für Schäden, die sie sich während der Arbeit zufügen. Ein Mitverschulden des Geschädigten kann allenfalls über die gesetzliche Mitverschuldensregelung des § 254 BGB berücksichtigt werden. (LAG Hamm, Urteil vom 21.09.2006 – 16 Sa 86/06)
Quelle: Entscheidung des BGH unter www.lag-hamm.nrw.de
Kategorie Arbeitsrecht